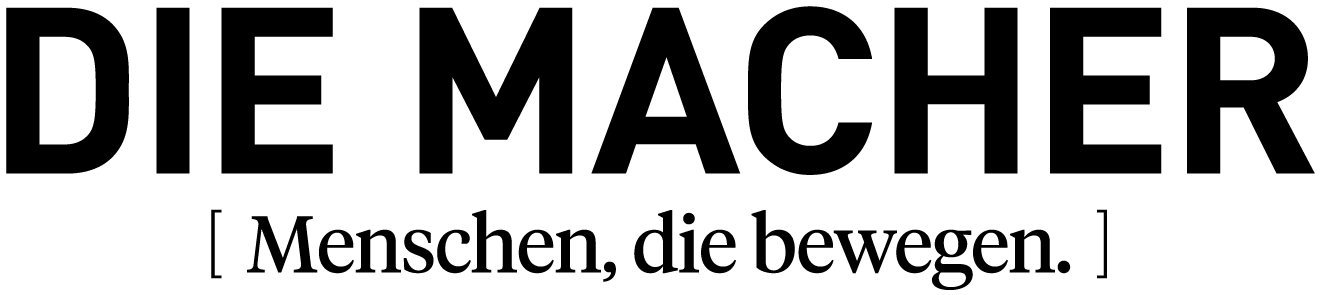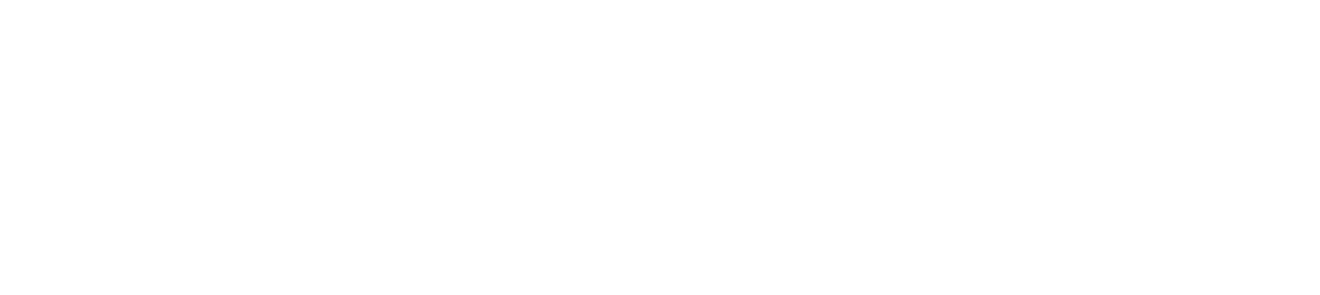Das europäische KI-Paradox
Wissenschaftliche Ergebnisse werden in Europa oft nicht wirtschaftlich verwertet – sondern nur publiziert und diskutiert. Das ist wichtig, bringt aber kein frisches Geld in die Forschung. „European Paradox“ nennt sich dieses Phänomen, das im Software-Bereich besonders stark auftritt. Die langfristigen Folgen: die Gefahr der Nicht-Finanzierbarkeit in der Spitzenforschung und Nachteile gegenüber anderen Standorten. Welche Gründe gibt es für das Paradox – und wie kann das Problem gelöst werden?
Eigentlich hätte Europa das weltweite KI-Zentrum werden können. Stattdessen hinkt man bei der Integration der Schlüsseltechnologie Künstliche Intelligenz klar hinterher, obwohl die Grundlagenforschung nach wie vor führend ist. Schon 1997 veröffentlichte der deutsche Informatiker Sepp Hochreiter gemeinsam mit Jürgen Schmidhuber eine Arbeit über Long short-term memory (LSTM). Die Technik ist zum wesentlichen Baustein der Entwicklung Künstlicher Intelligenz geworden – ohne sie wäre die Technologie heute wohl noch nicht so weit. LSTM-Technik ist in Google, Alexa und anderen Softwareprodukten integriert, damals erkannte noch niemand die Tragweite der Erfindung in Europa. Später erfand Hochreiter an der Linzer Johannes Kepler Universität „Self-Normalizing Networks“. Das Modell wurde nicht von europäischen Unternehmen, sondern zuerst von Amazon für Bewertungen und gezielte Werbung übernommen. „Damit haben sie binnen kürzester Zeit eine Milliarde Euro Umsatz mehr gemacht, als Dank habe ich bei einer Konferenz einen Mojito ausgegeben bekommen“, erinnert sich Hochreiter und lacht.
Europäer sind meist begeisterte Technologie-Enthusiasten. Die europäische Spitzenforschung erzielt in allen Gebieten herausragende wissenschaftliche Erkenntnisse und Ergebnisse. Das genannte Beispiel zeigt aber: Wirtschaftlich zahlt sich die Sache aber oft nicht aus. Die Universitäten und Forschungseinrichtungen sind und bleiben von öffentlichen Förderungen abhängig. Die Gründe dafür sind vielschichtig. „In Österreich spielen sich die „Kreisläufe“ von Forschung und Innovationen meist getrennt voneinander ab“, erklärt Markus Manz, Geschäftsführer des Software Competence Center Hagenberg. In der Forschung wird nahezu ausschließlich das technologische Problem adressiert, der Markt wird dabei meist außer Acht gelassen. So ist oft das Ergebnis eine Publikation oder ein Prototyp, der dann vielfach gar nicht für den Eintritt in den Markt positioniert wird. Das SCCH will das Problem angehen und den Technologietransfer von der Forschung in die Wirtschaft forcieren und dabei selbst auf Innovationen setzen.
Scouts, die nach Verwertbarem suchen?
Derzeit laufen Forschungsprojekte, die nicht direkt im Auftrag der Industrie passieren, hierzulande oft so ab: Nachdem Gelder für ein Projekt bewilligt wurden, beginnt die Forschung. Irgendwann ist die technologische Machbarkeit bewiesen, es kommt nach Publikationen zu Erwähnungen in renommierten Wissenschaftsmagazinen, möglicherweise auch zu einem Prototyp. Der technologische Erfolg, der vielfach beachtlich ist, ist das Ergebnis. Und dann – nichts. „Was aus den Ergebnissen danach wird, ist (noch) nicht in der DNA der europäischen Forschung. Nur in den seltensten Fällen wird der Markt, das Geschäftsmodell, die Innovation gleich mitgedacht“, sagt Manz, „es bräuchte Scouts, die zwischen Forschung und Industrie stehen und nach verwertbaren Ergebnissen suchen.“ Durch die fehlende Verwertung seien Forschungseinrichtungen und Universitäten kontinuierlich auf öffentliche Gelder angewiesen, die sonst beispielsweise durch Beteiligungen an neu gegründeten Unternehmen – sogenannte Spin-offs – lukriert werden könnten. Auch in Europa gibt es Beispiele, wie das funktionieren kann: So ist das Beteiligungsportfolio der ETH Zürich derzeit viele Milliarden Euro schwer.
Ein weiterer Grund für das Paradox ist für Manz das Mindset. „Wenn man in Tel Aviv oder im Silicon Valley Studierende fragt, wer von ihnen gründen will, melden sich die meisten.“ In Österreich hingegen würden die meisten einen risikoarmen, gut bezahlten Job in der Industrie bevorzugen. Auch Michael Haslgrübler, Area Manager im Bereich „Perception and Aware Systems“ bei Pro²Future, sieht das europäische Mindset als Erklärung für das Problem. „Wir tun uns hier in Europa schwer mit der Transition von wissenschaftlichen Ergebnissen zu vermarktbaren Innovationen, weil es an Risikokultur mangelt“, sagt er. Bestes Beispiel sei OpenAI mit ChatGPT. „Milliarden an Geldern sind dort vorab geflossen, ohne zu wissen, ob man irgendwas zurückbekommt.“
Das Forschungszentrum Pro²Future mit Sitz in Linz und Graz bringt KI in die industrielle Fertigung, man kooperiert mit mehr als 40 Industriepartnern und 30 wissenschaftlichen Einrichtungen und Instituten in Forschungsprojekten. Das COMET Forschungszentrum ist Schnittstelle zwischen Unternehmen und Wissenschaft und setzt damit direkt beim genannten Problem an. „Unsere Forschungsfragen sind von der Industrie inspiriert, Zielsetzung ist es, ein verwertbares Ergebnis zu erarbeiten“, erklärt Belgin Mutlu, Area Managerin im Bereich „Cognitive Decision Making“ bei Pro²Future. Unterstützung bei der Grundlagenforschung gibt es von Universitäten.
Wie funktioniert die Herangehensweise von Pro²Future? Haslgrübler: „Wir definieren gemeinsam mit Unternehmen eine Frage, mit der Zeit kommen weitere dazu, bis am Ende ein Prototyp entsteht, der auf Produktlevel gebracht wird und in der Infrastruktur des Betriebs zum Einsatz kommt.“ Dabei handelt es sich um mehrjährige Projekte. Wichtig sei eine realistische Erwartungshaltung. „Natürlich wissen europäische Unternehmen, dass man nicht gleich am nächsten Tag ein Produkt am Markt hat, wenn man mit der Forschung interagiert“, sagt Haslgrübler. Nachsatz: „Leider glauben manche, dass es am übernächsten Tag so weit ist.“ So funktioniere Forschung aber nicht – zumindest nicht bei Mitteln, die meist stark begrenzt sind. „Mache hoffen, dass sie mit einer Person, die sich vielleicht nur Teilzeit mit KI beschäftigt, Wunderwuzzi-artige Ergebnisse erzielen können.“ Um neue KI-Technologie möglichst schnell im eigenen Unternehmen zu integrieren, brauche es nicht nur Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem. „Es müssen auch unterschiedliche Disziplinen – von Softwareentwickler:innen über Mathematiker:innen bis hin zu Psycholog:innen vertreten sein“, sagt Mutlu.
„Wir werden das European Paradox für uns lösen“
Beim SCCH hat man sich hohe Ziele gesteckt – man will das European Paradox für sich lösen und zukünftig mit Forschungsergebnissen institutionalisiert Unternehmen gründen. „Wenn wir Erfolg haben, wird sich das hoffentlich herumsprechen und andere werden folgen. Wenn wir scheitern, haben wir viel gelernt und werden es weiter versuchen“, sagt Manz. Beispiel dafür, wie eine direkte Übersetzung von wissenschaftlichen Ergebnissen in Innovation funktionieren könnte, ist das geplante Spin-off „Birth.AI“: Gemeinsam mit dem KUK Kinderwunsch Zentrum am Kepler Universitätsklinikum wurde am SCCH ein neues Verfahren zur Unterstützung von Invitro-Fertilisation (IVF)-Behandlungen mittels KI entwickelt, „Birth.AI“ soll künftig als eigenes Unternehmen die Ergebnisse umsetzen. Thomas Ebner, Leiter des IVF-Labors am Kinderwunsch Zentrum, trat an das SCCH mit einer Idee heran, ein Modell zur Bewertung von befruchteten Eizellen (sogenannten Blastozysten) auf Basis von künstlicher Intelligenz (KI) zu schaffen. „Nach dem Training mit 600 Bildern war die KI in Teilbereichen schon so gut wie erfahrene Embryolog:innen, je mehr Daten desto unschlagbarer wird sie im Vergleich“, sagt Manz, der derzeit die Gründung vorantreibt.
„Birth.AI“ erzielte in jüngster Vergangenheit bereits einige Preise – davon kann man natürlich nicht leben. Seit Kurzem ist man auf der Suche nach Investoren. „In Israel gab es für eine ähnliche Technologe rund 30 Millionen Euro Investorengelder, das wird bei uns nicht klappen – aber technologisch auch dort wird nur mit Wasser gekocht“, sagt Manz._
Es mangelt an Risikokultur.
Michael Haslgrübler
Area Manager, Pro2Future
In Österreich laufen die Kreisläufe von Forschung und wirtschaftlichen Entwicklungen meist getrennt voneinander ab.
Markus Manz
Geschäftsführer, SCCH
Künstliche Intelligenz am Campus Burghausen
Wie verändert sich der Hochschulbetriebetrieb durch Künstliche Intelligenz (KI)? „Es gibt immer wieder Forderungen, den ChatGPT-Zugang an Hochschulen zu sperren, das ist sicherlich falsch. Auch bei Wikipedia oder Google wurde das Werkzeug nicht gesperrt“, sagt Arno Bücken, Studiendekan für Prozessautomatisierungstechnik am Campus Burghausen der Technischen Hochschule Rosenheim und Professor für Informatik mit Schwerpunkt Datenanalyse. „Man stelle sich vor, man würde heute eine Recherche ohne Google betreiben und dürfte nur in der Bibliothek suchen – man käme viel weniger weit.“
ChatGPT lade als Werkzeug aber dazu ein, falsch benutzt zu werden. „Ausgearbeitete Texte sehen auf den ersten Blick recht plausibel aus, sind es manchmal aber bei genauerer Überprüfung nicht“, erklärt Bücken. Die KI sei in der aktuellen Version nicht zitierfähig. „Das macht den Umgang schwierig, ich ermutige meine Studierenden aber, KI als Werkzeug für ein Grundgerüst zu verwenden und dann selbst weiterzuarbeiten.“
Am Campus Burghausen wird KI gerade in einem vom Fonds der Chemischen Industrie geförderten Recycling-Teststand eingesetzt, der von Studierenden der Studiengänge Umwelttechnologie, Prozessautomatisierungstechnik und Chemieingenieurwesen genutzt wird. „Es geht darum, verschiedene Kunststoffarten zu erkennen und zu sortieren, damit sie bestmöglich recycelt werden können“, sagt Bücken. Anhand von Infrarotspektroskopie werden Datensätze aufgezeichnet, mit denen neuronale Netzwerke erkennen, welche Kunststoffe am Förderband gelandet sind. „Studierende werden mit Datenanalyse und Automatisierung vertraut gemacht und können mittels KI Lösungen für komplexe Sortierprobleme erarbeiten.“
Studierende können mittels KI Lösungen für komplexe Sortierprobleme erarbeiten.
Arno Bücken
Studiendekan, Campus Burghausen
#Weitere Artikel

Wie die KI Patentspezialisten unterstützt
Den Kopf angesichts der rasanten Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz in den Sand zu stecken, das war für ABP aus Windischgarsten nie eine Option. Da im Patentwesen hohe Sicherheitsansprüche herrschen, boten herkömmliche Large Language Models keine Anwendungsmöglichkeit. Deswegen haben die beiden Unternehmen ABP Patent Network und Anwälte Burger und Partner die Sache selbst in die Hand genommen und gemeinsam mit IBM eine eigene KI-Anwendung entwickelt, die ein echter Gamechanger für den Intellectual-Property-Bereich sein wird.

Duell im Cyberspace
Tennis und Cyber-Resilienz, wie passt das zusammen? Auf den ersten Blick eher weniger. Das „AKARION Cyber Resilienz Forum“ belehrte eines Besseren. Als Organisator des Events lud der Softwarelösungsanbieter Akarion Interessierte, Unternehmen sowie Expert:innen zu einer Networkingveranstaltung rund um das Thema Cyber- und Informationssicherheit ein – als eines der Sideevents des Tennisturniers Upper Austria Ladies 2024. Am Programm: spannende Vorträge, reges Netzwerken, und als überraschender Abschluss ein Meet & Greet mit Tennis-Weltstar Barbara Schett. Ein würdiger Opening Act für das folgende Qualifikationsspiel zwischen Angelique Kerber und Lucia Bronzetti.

Was du heute kannst besorgen …
… das digitalisiere nicht erst morgen! Denn wenn es darum geht, bestehende Mitarbeitende zu binden und auch in Zukunft neue Talente für sich zu gewinnen, ist ein modernes Recruiting schon heute unerlässlich. Mit Vortura Solutions fokussieren sich Geschäftsführer Joachim Ortner und sein Team daher auf die digitale Mitarbeitergewinnung, die weit über klassische Stellenanzeigen hinausreicht.

„Wir sind digitaler Wegbegleiter für das Gemeindeleben“
Die optimierte Version der „GEM2GO APP“ soll Gemeinden eine 360°-Kommunikation mit den Bürger:innen ermöglichen. Das Update will mehr Individualität bringen und den Umgang für die Nutzer:innen intuitiver machen.

Wenn die Fabrik ihr „Hirn“ einschaltet
16.000 Tonnen Stahl, Edelstahl und Aluminium werden hier durch die Synergie aus Mensch und Maschine jährlich verarbeitet. Wo? Im Mekka der Stahlbranche: Oberösterreich. Genauer gesagt bei AHZ Components. Seit der Gründung im Jahr 1999 setzt der Lohnfertigungsbetrieb aus Sipbachzell auf Maschinen des Schweizer Herstellers Bystronic. Über eine außergewöhnliche Zusammenarbeit zwischen Hemdsärmeligkeit, Präzision und Serviceorientierung.

Wir fragen, die KI antwortet
Unternehmen, die neue Talente für sich gewinnen wollen, sowie Menschen auf Jobsuche wissen genau: Der Weg zum Perfect Match ist meist kein entspannter Spaziergang, sondern gleicht eher einer Achterbahnfahrt. Welche Abkürzungen helfen, dass beide Seiten schneller zueinander finden? Wir fragen zwei „Experten“ – im „Interview“ mit Google Bard und ChatGPT.

KIss it? KIck it? KIll it? – Der richtige Umgang mit einem ständig ausbrechenden Vulkan
Vor wenigen Monaten für viele noch eine abstrakte Zukunftsvision, mittlerweile längst in vielen Unternehmen etabliert: Künstliche Intelligenz hat sich in der Arbeitswelt im Eiltempo durchgesetzt – dabei hat der Wandel gerade erst so richtig begonnen. Warum es bei der Umsetzung vor allem auch auf das richtige Mindset ankommt, weiß Albert Ortig. Der Digitalisierungspionier unterstützt mit Netural Unternehmen bei der Implementation der Technologie und kennt klassische Fehler und Irrtümer. Ortig selbst hat sich als Teil des Startups NXAI kein geringeres Ziel gesetzt, als ein Large Language Model zu etablieren, das GPT und Co. in den Schatten stellen könnte.

Einmal entspannt zurücklehnen, bitte!
Was würde passieren, wenn wir Digitalisierung nicht nur um der Digitalisierung willen betreiben? Der Ansatz des IT-Dienstleisters NTS zeigt, warum es so wichtig ist, dieses Konzept holistisch zu denken. Helmut Hödl, Product and Technology Director, und Daniel Knauer, Territory Manager Oberösterreich, sprechen mit uns darüber, was Digitalisierung aus ihrer Sicht bedeutet und wie sie bei ihnen gelebt wird.

Was wir einen B2B Storyteller immer schon mal fragen wollten
Früher haben Menschen ihre Geschichten am Lagerfeuer ausgetauscht. Während das Lagerfeuer heute längst der digitalen Welt gewichen ist, ist eine Sache gleich geblieben: die Freude an gut erzählten Geschichten. Aber was macht gelungenes Storytelling aus? Und wie geht echte „B2Begeisterung“? Das verrät uns Andi Schwantner – er schult und begleitet Unternehmen sowie Führungskräfte strategisch und hilft bei ihren Auftritten in der digitalen Öffentlichkeit mit individuellen Markenbotschafterprogrammen und Corporate-Influencer-Initiativen. Ein Experte, zehn Fragen.

E = L x K²
Oder anders ausgedrückt: Erfolg ist das Ergebnis von Leistung mal Kommunikation zum Quadrat. Warum unsere ureigenen menschlichen Fähigkeiten wie etwa Kommunikationsstärke uns dabei helfen werden, trotz Aufschwung der Künstlichen Intelligenz relevant zu bleiben, und warum die KI im Grunde eine Chance ist, uns neu zu erfinden, erzählt Life- und Businesscoach Roman Braun im Interview.

„Ohne Mensch keine Automatisierung“
Warum spielt der Faktor Mensch in Automatisierungsprozessen eine so große Rolle? Was ist der aktuelle Stand zum Einsatz von Robotern in der Industrie? Und welche Veränderungen der bisherigen Arbeitswelt werden dadurch künftig auf uns zukommen? Wir diskutieren mit drei Experten.

Auf Mission in „Europas Hauptstadt“
„CommunalAudit ist ein Benchmarking- und Management-Werkzeug für Gemeinden. Mit Newsadoo ermöglichen wir Unternehmen und Organisationen, Zielgruppen in ihren Webseiten, Apps oder im Intranet komplett automatisch mit relevanten Inhalten versorgen – ein Anwendungsbereich davon sind vollautomatische Gemeinde-News-Plattformen.“ Beide oberösterreichischen Projekte zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung haben das Interesse in Brüssel geweckt, weshalb Ramsauer & Stürmer CommunalAudit-Geschäftsführer Georg Platzer gemeinsam mit Newsadoo-Geschäftsführer David Böhm zu einer Präsentation ins Europäische Parlament eingeladen wurde.

Wie ein Ransomware-Angriff abläuft – und überstanden wird
Das Innviertler Kunststoff- und Metallverarbeitungsunternehmen Promotech verlor durch einen Hackerangriff vorübergehend sämtlichen Zugriff auf die eigene IT. Durch umfassende Vorbereitung, schnelles Handeln und die Unterstützung der TEMS Security konnte man die Krise überstehen – und sogar gestärkt aus ihr gehen.

„Vertrauenswürdige KI ist ein wichtiger Erfolgsfaktor“
Oberösterreich soll bis 2030 zu einer Modellregion für Human-Centered Artificial Intelligence werden. Welche Zutat für Landeshauptmann Thomas Stelzer im Erfolgsrezept dieser KI-Hochburg auf keinen Fall fehlen darf? Ethische Standards, die die nötige Sicherheit und einen vertrauenswürdigen Umgang mit dieser Zukunftstechnologie gewährleisten.

The Power of Podcasts
Podcasts gehen ins Ohr – persönlich, ohne Umwege und ganz nah. Das machen sich auch Unternehmen vermehrt zu Nutze, indem sie ihre interne oder externe Kommunikation um einen Corporate Podcast erweitern. Die Podcastagentur wepodit unterstützt dabei und Geschäftsführerin Eva Langmayrs Begeisterung für das noch vergleichsweise junge Medium steckt nicht nur ihre Kund:innen an.

„Fehler haben wir bei uns in Fuck-up-Stories umbenannt“
Die gesamten Hierarchieebenen abschaffen, eine neue Meetingkultur etablieren und, statt Fehler zu rügen, gemeinsam in Fuck-up-Stories über sich selbst lachen – klingt nach ganz schön großen Veränderungen, oder? Für Roger Hafenscherer stand gleich zu Beginn seiner Tätigkeit als Geschäftsführer des Luft- und Umwelttechnikunternehmens Sirocco fest, dass er keinen Stein auf dem anderen lassen würde. Und nach zwei Jahren zeigt sich: Sein empathischer und authentischer Führungsstil trägt Früchte.

Covershooting: Ines und die Sache mit der KI
Okay, wir brauchen eine Fotolocation, die irgendwie nach Zukunft aussieht. Immerhin reden wir über Zukunft. Roger Hafenscherer, Eva-Maria Pürmayer und Anita Thallinger erzählen in unserer Coverstory, wie sie sich diese vorstellen. Und wie sie ihr Mindset schon jetzt dafür programmiert haben. Anstatt einer Location haben wir Ines Thomsen gefunden – eine Pionierin beim Ausprobieren von Künstlicher Intelligenz in der Fotografie.

„KI wird Wissenslücken schließen“
Upart-Geschäftsführer Daniel Frixeder und Beratungsleiter Christian Schmid erzählen
im Interview, wie Künstliche Intelligenz den Arbeitsalltag in einer Werbeagentur verändert, welches Potential die Technologie bietet – und warum sie trotz der rasanten Entwicklung nicht um die Zukunft der klassischen Werbeagentur bangen.