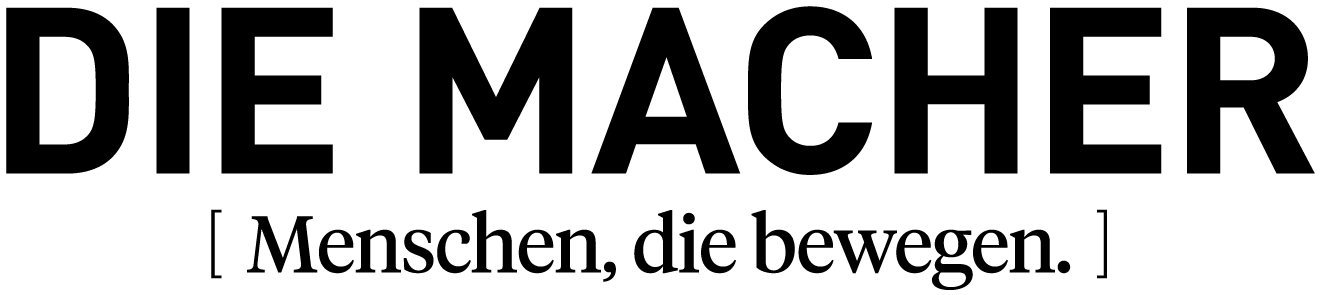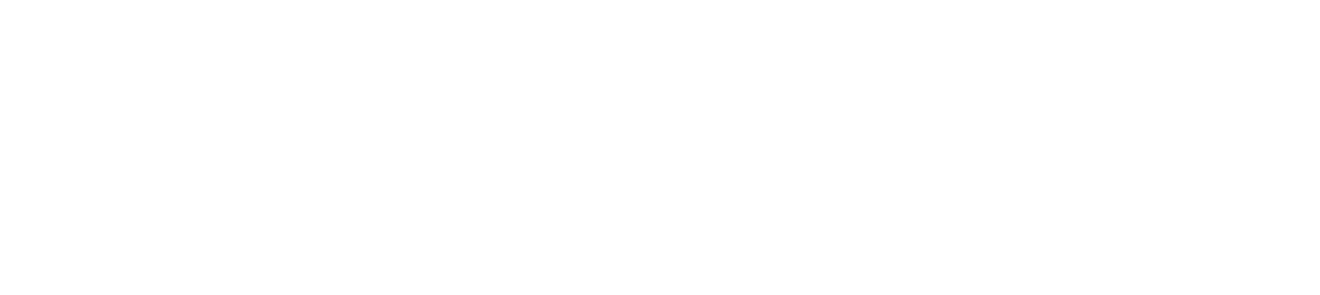„Die Welt, für die unsere Schulen gemacht worden sind, existiert nicht mehr“
Schule: die Bildungsinstitution schlechthin. Ein Ort, an dem Bildung und Erziehung zusammenkommen, Werte vermittelt und ganze Generationen geprägt werden. Mit dem großen Ziel, unsere Gesellschaft voranzubringen und Persönlichkeiten
in ihr zu entwickeln. So zumindest die Idealvorstellung.
„Schulen hatten jedoch noch nie die Aufgabe, Heranwachsenden bei der Entfaltung ihrer Potentiale zu helfen. In allen Gesellschaftsformen ging es darum, sie auf die Aufgaben vorzubereiten, für die sie später gebraucht wurden“, entzaubert Gerald Hüther dieses Wunschdenken. Als renommierter Neurobiologe übt der Vorstand der Akademie für Potentialentfaltung konstruktive Kritik an den Schwächen der Schul- und Bildungssysteme. „Es kommen schließlich genug junge Erwachsene aus unseren Schulen, die nicht wissen, was sie wollen, die kaum Gelegenheit hatten, sich ihrer eigenen Gestaltungskraft bewusst zu werden, deren Lust am Lernen und am Tätigsein weitgehend verloren gegangen ist und die sich deshalb sehr gut durch alle möglichen Angebote verführen und manipulieren lassen“, so Hüther.
Eine Frage des Systems
Ein entscheidender Fehler im Umgang mit der Schule, wie wir sie kennen, sei die immense Bedeutung, die wir ihr zuschreiben. „Wer oder was zwingt uns, die Schule so ernst zu nehmen, uns oft sogar zum Erfüllungsgehilfen ihrer verordneten Lehrpläne und Vorgaben zu machen und unsere Kinder und Jugendlichen auch noch selbst unter Druck zu setzen und sie am spielerischen Erkunden ihrer eigenen Möglichkeiten zu hindern, weil sie dafür gar keine Zeit mehr haben?“, hinterfragt Hüther den Status quo und spricht von einer Mücke, die zum Elefanten aufgeblasen wurde.
Während gesamtgesellschaftlich die negativen Stimmen gegen vermeintlich inkompetente Lehrkräfte immer lauter werden, geht der Hirnforscher mit den Betroffenen weniger hart ins Gericht. „Die meisten Lehrer:innen machen es so gut sie können. Sie brauchen unsere Unterstützung, denn sie sind größtenteils auch Opfer dieses Systems.“ Für den Experten stoßen viele von ihnen durch die derzeitigen Strukturen an die Grenzen ihres Schaffens. Es sei daher kaum verwunderlich, den natürlichen Impuls sowie den Grund dafür, warum man den Job einst ergriffen hat, allmählich immer mehr zu unterdrücken.
„Es bilden sich dann hemmende Nervenzellverschaltungen im Hirn und die unterdrücken die Vernetzungen, aus denen eigentlich Fürsorge und Aufgeschlossenheit entspringen“, erklärt der Neurobiologe. Schulen und damit auch die dort tätigen Lehrpersonen würde er aus diesem Grund von allem entlasten, was dort gar nicht geleistet werden könne. Bildung für ein gelingendes Leben würde so zur zivilgesellschaftlichen Aufgabe und müsste dort stattfinden, wo auch das Leben stattfindet, lautet Hüthers Vorschlag.
Wenn nicht mehr alles benotet werden würde …
… und Noten dadurch nicht mehr alles wären, würden die Bildungs- und Entwicklungsprozesse hinter den Zensuren eine neue Wertigkeit erfahren. Denn auf die Frage, ob Kinder Schulnoten bräuchten, gibt der Experte eine klare Antwort: „Wozu? Wer sie braucht, sind die weiterführenden Ausbildungseinrichtungen, also Berufsschulen oder Universitäten, die sich weigern oder zu faul sind, sich die geeigneten Bewerber:innen im persönlichen Gespräch selbst auszusuchen.“ Es könne ihm zufolge schließlich nicht sein, dass ein Notendurchschnitt darüber entscheidet, ob jemand Medizin studieren kann oder nicht. Wie sein direkter Vergleich mit Fahrschulen belegt, lernen dort auch Jugendliche mit schlechteren Schulnoten das Autofahren und die Verkehrsregeln. „Da ist die Frage: Was bringt sie dazu, das alles zu lernen, wo sie doch sonst so gut wie nichts lernen wollen? Und die Antwort ist ganz banal: In der Fahrschule ist die Person, die den Schüler:innen beim Lernen hilft, nicht gleichzeitig die Person, die sie prüft.“ Was er damit meint? „Lehrkräfte begleiten Schüler:innen dabei, zu lernen, wie etwa Fotosynthese funktioniert. Aber das Zertifikat, das das Wissen über die Funktionsweise der Fotosynthese bestätigt, das ist woanders abzulegen“, erläutert Hüther seine Idealvorstellung.
Für ihn ist diese Trennung ein echter Gamechanger. „Ist dies nicht der Fall, entsteht eine Haltung und die heißt: null Bock auf Schule. Was wir unseren Kindern aber eigentlich wünschen sollten, ist, dass sie positive Erfahrungen bei ihren Versuchen machen, sich in der Welt zurechtzufinden“, erklärt Hüther. Dabei gehe es weniger darum, Wissen abzurufen, sondern um Kompetenzerwerb – etwa die Fähigkeit, eine Handlung zu planen und die Folgen einer Handlung abzuschätzen, Impulse zu kontrollieren, Frust auszuhalten, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. „All das lässt sich aber nicht unterrichten, man kann dafür keine Schulstunde einführen. Sondern die Kinder und Jugendlichen müssen Gelegenheit haben, die Erfahrung zu machen.“ Für ihn steht daher fest: Die besten Lehrmeister, um herauszufinden, wie etwas geht, sind die Fehler, die bei diesen spielerischen Erkundungen immer wieder gemacht werden dürfen._
Wie das Leben geht, kann man nur im wirklichen Leben lernen.
Gerald Hüther
Neurobiologe und Vorstand, Akademie für Potentialentfaltung
#Weitere Artikel

Unsere jetzigen Limits sind erst der Anfang
Wohin werden sich AI-Tools in den kommenden Jahren entwickeln? Mit welchen rechtlichen und gesellschaftspolitischen Fragen müssen wir uns auf Basis dessen auseinandersetzen? Und warum stehen wir eigentlich erst ganz am Anfang der Entwicklungen? Wir haben bei zwei Experten des Software Competence Center Hagenberg, Michael Moser und Bernhard Nessler, nachgefragt.

Lernen neu gelebt
Was würde passieren, wenn wir bei Kindern die Freude am Lernen erhalten, statt sie ihnen im Laufe des Lebens zu nehmen? Wie können wir als Zivilgesellschaft das Thema Bildung neu denken und Erwachsene formen, die ihre Ideen aktiv einbringen? Mit diesen großen Fragen beschäftigt sich das junge Unternehmen chabaDoo. Die beiden Gründer erzählen uns, warum sie im Bildungsbereich etwas bewegen wollen und wie ihre Lernplattform dazu beiträgt.

Warum der Kopf rund ist …
… und wie das mit erfolgreichem Networking zusammenhängt? Gerhard Pichler, Geschäftsführer von Business Circle, verrät es uns. Über den Dächern von Wien arbeiten er und sein Team als Content Provider und Enabler eng mit der österreichischen Wirtschaft zusammen. Im persönlichen Gespräch teilt er seine
fünf wichtigsten Learnings, um Wissensvermittlung und Netzwerken in Einklang
zu bringen.

Müssen wir Bildung neu denken?
Das sagt unsere Community

Die Zukunft erforschen
Distance Learning, aufkeimende Wissenschaftsskepsis und Diskussionen über die Finanzierung von Universitäten – die österreichischen Hochschulen haben in letzter Zeit bewegte Momente erlebt. Nichtsdestotrotz wollen heimische Bildungseinrichtungen die Zukunft erforschen und vermitteln. Die Montanuniversität Leoben und die Kepler Society, das Alumni- und Karrierenetzwerk der Johannes Kepler Universität Linz, eint nicht nur ihr Zukunftsfokus, sondern auch ähnliche Lehren für die Lehre von morgen.

„Der Mensch steht im Mittelpunkt der Digitalisierung“
Wie verändern sich Banken durch die Digitalisierung , wo profitieren Kund:innen, welche Risiken gibt es – und warum bleibt auch trotz neuer Technologien der Mensch immer im Mittelpunkt? Darüber haben wir mit Stefanie Christina Huber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse OÖ, gesprochen.

„Hochschulen müssen einen Schritt voraus sein“
Die Technische Hochschule Rosenheim mit dem Campus Burghausen gilt als wichtigste Bildungseinrichtung Südostoberbayerns. Arno Bücken, Studiendekan des Bachelorstudiengangs Prozessautomatisierungstechnik, erklärt, wie Studierende auf eine digitale Welt vorbereitet werden und vor welche Herausforderungen die digitale Transformation Hochschulen stellt.

Wer die besten Köpfe sucht …
… findet diese nicht immer auf Anhieb. Oder anders formuliert: Der Fachkräftemangel zählt zu den größten Gefahren am österreichischen Arbeitsmarkt. Über eine historische Herausforderung für die heimische Wirtschaft.

Begeisternde Begegnung inmitten einer grünen Oase
Das Schloss Puchberg bei Wels zählt zu den größten Häusern der Erwachsenenbildung in Österreich. Umringt von einem Park machten wir uns vor Ort selbst ein Bild vom herrlichen Ambiente. Im Interview haben uns Direktor Helmut Außerwöger und sein Team bei einem Rundgang durch das Haus einen genauen Einblick gewährt.

Gestatten, hier operiert der Robo-Doc!
Gesteuert mittels einer Konsole sind weltweit immer mehr Roboter bei
Operationen im Einsatz. Ein Linzer Topchirurg hat mit dem Robo-Doc
schon 100 Mal zusammengearbeitet und erklärt uns die Vorteile.

Willkommen in der Schule von morgen
Schulschließungen, Distance-Learning oder Präsenzunterricht mit Maske – unser Bildungssystem hat während der Pandemie verschiedenste Stadien durchlaufen. Wie sieht das Klassenzimmer der Zukunft aus und was kann man aus der Krise mitnehmen? Wir haben bei einer Schülerin, einer Lehrerin bis hin zum Unidirektor nachgefragt, wo die Reise im Bildungssystem hingeht.

Dem Mangel ein Schnippchen schlagen
Die Lage der heimischen Wirtschaft kann man derzeit mit einem lachenden, aber auch einem weinenden Auge sehen. Denn der Aufschwung über Vorkrisenniveau trifft auf eines der wohl präsentesten Probleme am Arbeitsmarkt: den Fachkräftemangel.

„Trotz Corona weiter unser Traumberuf“
Rund zwei Jahre Pandemie waren vor allem für Menschen in Gesundheitsberufen fordernd. Im Gespräch mit uns schildert der leitende Intensivpfleger des Salzkammergut-Klinikums Vöcklabruck, Christian Schindlauer (44), die emotionalsten Momente und verrät, warum sein Job für ihn immer noch der Traumberuf ist.

Wie die Gleichung aufgeht
Geht es um Chancengleichheit und Gleichbehandlung, gibt es hierzulande noch einiges an Aufholbedarf. Im EU-weiten Gender Equality Index liegt Österreich unter dem Durchschnitt. Doch was machen Länder wie Schweden, Dänemark und Frankreich besser? Und wie ist die (arbeits)rechtliche Lage in Österreich zu bewerten?

Gedankensprung … mit Montanunirektor Wilfried Eichlseder
Sind eigentlich auch Frauen unter den Bergleuten? Wie hat sich das Studenten-Dasein in den vergangenen Jahren verändert? Wie studiert es sich in Leoben und wie halten Sie es mit der Nachhaltigkeit, Herr Rektor? Das und mehr klären wir im persönlichen Gespräch.

„2021 lautet unser Motto: Arbeit, Arbeit, Arbeit“
Das Jahr 2021 wird ein Jahr voller Herausforderungen. Doch Zeiten des Umbruchs bieten immer auch eine Gelegenheit, sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Die Oberösterreichische Volkspartei rückt deshalb Weiterbildungsangebote in den Fokus.

Was wäre, wenn …
… ich in meinem Leben alles richtig gemacht hätte? Für Wilfried Eichlseder, Rektor der [Montanuniversität Leoben](https://www.unileoben.ac.at/), ist dies keine hypothetische Frage. Er ist davon überzeugt, dass er auf einem richtigen Weg ist. Diese Lebenseinstellung weckt unser Interesse an anderen „Was wäre, wenn“-Wunschgedanken des gebürtigen Oberösterreichers.

Was Manager von Spitzensportlern lernen können
Sie wollen dasselbe: gewinnen! Den Wettkampf. Den Pokal. Das Spiel. Neue Kunden, innovative Ideen, Ansehen. Aber der Weg zum Sieg ist für den Sportler meist ein anderer. Einer, von dem auch Manager etwas für sich lernen können.