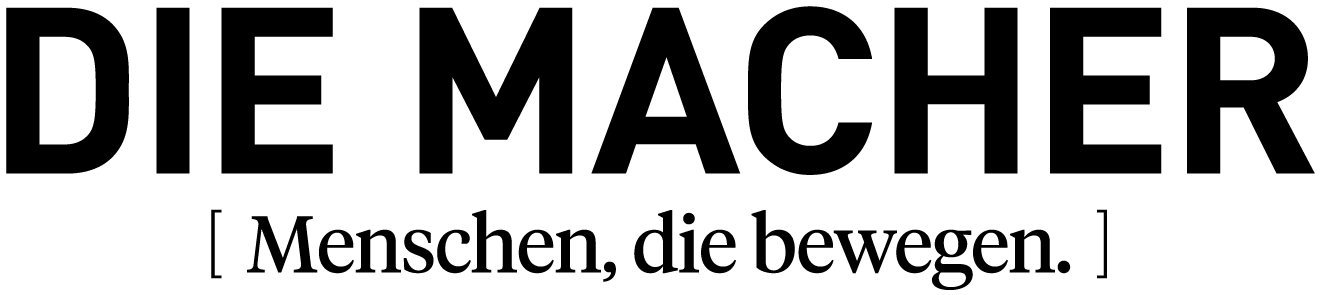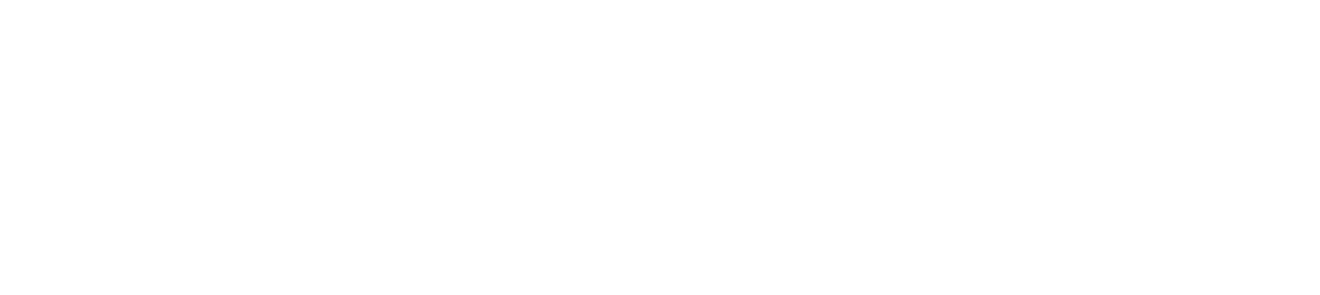Südtirol, wer bist du?
Eigentlich war alles klar: Südtirol, das ist das Land mit den Wanderwegen, Skipisten, Apfelplantagen. Die Region zwischen Deutsch und Italienisch, zwischen Tradition und Genuss. Gemütlich. Ruhig. Aber dann treffen wir Michael. Und Mattia, Marion, Ben, Josef und Florian. Und plötzlich ist klar: Hier passiert noch etwas. Mehr als Apfelsaft, vielfältiger als Schlutzkrapfen, vielleicht sogar größer als die Dolomiten. Hier wird Zukunft gemacht.
„Un caffè, per favore.“ What else? Wir sind ja in Italien. Denken wir jedenfalls (und der Kaffee schmeckt auch dementsprechend), aber schon bald fangen wir an, zu hinterfragen, wo wir hier wirklich sind. Der Reihe nach. Wir treffen also Michael Atzwanger an einem kleinen, runden Tisch im Garten der Noisteria und trinken Espresso. Die Noisteria, das ist das beliebte Lokal am NOI Techpark in Bozen.
Studierende mit Laptops, Forscherinnen und Forscher in Gesprächen, Menschen, die zwischen Büros und Laboren pendeln. Ein Gewimmel aus fünfzehn verschiedenen Sprachen, die meisten Leute reden Englisch oder Italienisch miteinander, manche Deutsch. 2.400 Menschen, die hier täglich unterwegs sind. Das ist der NOI Techpark. Südtirols Innovationsviertel in Bozen. Entstanden auf dem Gelände einer ehemaligen Aluminiumfabrik, die einst zwei Drittel des italienischen Bedarfs deckte. Heute stehen hier vier Gebäude aus Glas und Stahl zwischen den Dolomiten. 68 Labore. 769 laufende Forschungsprojekte. Ein Budget von 59,2 Millionen Euro.
Wie man Berge versetzt
„Es ist schon verrückt“, sagt Michael und deutet nach hinten über seine Schulter. „Dort siehst du die Berge, hier drinnen forschen Leute an der Zukunft des Essens.“ Seine Augen leuchten, wenn er von fünf Jahren Entwicklung erzählt. Von Träumen, die Realität wurden. Von Sojabohnen, die Europa verändern könnten. „Wir waren hier lange ein Nachzügler in Sachen Innovation“, sagt er. Das sei Vergangenheit. Das NOI – eine Art architektonisches Wunder aus Glas und Stahl, wo Welten verschmelzen. Eurac, Universität Bozen, Fraunhofer-Institute, 30 Startups, eine neue Fakultät für Ingenieurwissenschaften. „Diese Interaktion zwischen Forschungszentren, Unternehmen und Startups ist spürbar.“
Michael ist Finanzmanager des Startups HiWeiss. Er führt uns durch Korridore, die aussehen wie aus einer Architekturzeitschrift, zeigt uns einen riesigen Raum, der für Veranstaltungen genutzt werden kann, erzählt währenddessen: „Wir haben hier hochinnovative Unternehmen.“ Und dann sind wir angekommen – im HiWeiss-Labor, in seinem Labor. Er hebt ein Glas mit einer weißen Substanz hoch: Sojamehl. Nicht irgendeines. „Bei uns ist der Prozess so, dass er keine chemische Veränderung produziert.“ Fünf Jahre Entwicklung stecken in diesem Glas. 100 Prozent natürlich. 100 Prozent Clean Label. „Unser Ziel ist, italienische, gute Produkte zu machen, die alle gern essen, die allen Freude machen und von denen keiner weiß, dass die vegan sind. Aber sie sind vegan.“
Wo Ideen wachsen können
Mit zwei patentierten Verfahren produziert HiWeiss pflanzliche Proteine, die sich sowohl durch Nährwert als auch durch Funktionalität auszeichnen; biologisch und technologisch – aus gentechnikfreien Erbsen und Sojabohnen. „Der Markt ist stark interessiert an dem, was wir machen.“ Zwei Industrieanlagen hat HiWeiss mittlerweile. Der Trend gehe dahin, dass die Lebensmittelhersteller nur noch europäisches Soja beziehen möchten. Auf diese Nachfrage muss man reagieren – wenn man kann. Und in Südtirol scheint man es zu können. „Wir haben eine sehr effiziente Innovationsförderung in Südtirol. Wenn man bei uns hier eine gute Idee hat, dann wird man gefördert.“
Eine verdammt gute Idee hatte auch Mattia Baroni. Er öffnet ein kleines Glasfläschchen. „Riecht mal“, sagt er und hält uns eine Flüssigkeit unter die Nase, die aussieht wie flüssiger Bernstein. „Das ist aus Fischköpfen entstanden. Aus dem, was andere wegwerfen.“ The Garum Project. Aus dem, was die Welt nicht mehr will, entsteht etwas, wonach sie sich sehnt. Umami, der fünfte Geschmack. Der, der alles andere verstärkt. Inspiriert von der antiken römischen Fischsauce Garum entwickelt re.garum moderne Umamibooster aus pflanzlichen und tierischen Nebenprodukten. Das Sortiment umfasst fünf Sorten. Mattia ist einer dieser Menschen, die Südtirol zu dem machen, was es ist. Ein Koch aus der Sternegastronomie und Forscher aus Italien, der hierher kam, weil er hier fand, was er suchte: „Die Infrastruktur“, erklärt er, „die Förderungen. Die Möglichkeiten.“ Er spricht von Transdisziplinarität, von der Verbindung verschiedener Wissenschaften. Von Lösungen, die größer sind als ihre Einzelteile. Wie zum Beispiel seine Lösung für 220.000 ausgediente Legehennen, die jedes Jahr in Südtirol anfallen. Bio-Hennen, die zu alt geworden sind zum Eierlegen. Zu klein für die industrielle Schlachtung, landen sie normalerweise im Müll. Mattia verwandelt sie in flüssiges Gold: in Chicken Garum. In Geschmack, der Salz überflüssig macht und gleichzeitig nährt.
Innovation? Natürlich
Wenn er die Fermentationsprozesse erklärt, wird aus Biochemie Poesie. Pilze und Bakterien verwandeln Komplexes in Einfaches. Machen aus unverdaulich verdaulich. Aus geschmacklos geschmackvoll. „Die Natur macht die Arbeit“, sagt er, „wir müssen nur zuhören.“ Südtirol hört zu. Die Provinz unterstützt Projekte wie seines mit 65 Prozent Förderung für die Labornutzung. EU-Gelder fließen. Horizon-Programme werden bewilligt. Hier, an der Schnittstelle zwischen deutscher Gründlichkeit und italienischer Kreativität, entstehen Lösungen für Probleme, die viele noch gar nicht als solche erkannt haben.
Überhaupt scheint hier in Bozen die Kulinarik der Zukunft gekocht zu werden. Marion Egger zeigt uns das Kitchen Lab des NOI. Die Küche glänzt, Edelstahl überall. „Hier entstehen die Lebensmittel von morgen. All diese Labore stehen den Unternehmen offen“, erklärt Marion, die hier im NOI für Kommunikation und Events zuständig ist. Ben Schneider kommt dazu – der gebürtige Deutsche hat hier in Südtirol seine Heimat gefunden, sein Verantwortungsbereich ist Food Prototyping & Experience. Im Kitchen Lab begleiten sie Projekte von der ersten Marktanalyse bis zum fertigen Prototyp. 25 Projekte sind für dieses Jahr geplant, Anfragen gebe es aus ganz Europa. „Entscheidend ist dann der Sprung vom Labor zur Fabrik. Du kannst in der Küche viel im kleinen Maßstab machen, aber irgendwann musst du den Schritt in die größere Skala gehen.“ Deshalb planen sie das Food Technicum, ein Pilot Lab, wo Träume industriell werden. Wo aus Rezepturen Realitäten werden.
Wenn man in den sauren Apfel beißt
Am Weinsepphof in Lana bei Meran ist eine Rezeptur bereits Realität geworden. Josef Holzner greift nach einem rotfleischigen Apfel, er dreht ihn in der Hand. „Für den Frischkonsum sind sie nicht so geeignet, weil sie sehr säuerlich sind.“ Eine Sackgasse? Nicht für ihn. 2019 übernahm er den familiären Obstbaubetrieb. Mit ihm kam die Frage: Was tun mit Äpfeln, die zu sauer sind für den direkten Verkauf? „Dann bin ich auf das Thema Verarbeitung gekommen.“
So beginnen Innovationen. Nicht mit großen Plänen. Sondern mit Problemen, die nach Lösungen verlangen. Der erste Versuch: Cider. Doch das Ergebnis enttäuschte. Die leuchtende Rotfärbung verschwand während der Gärung. Manche würden hier aufgeben, Josef dachte weiter. „Dann bin ich auf das Thema gekommen, Saft zu machen, zu filtrieren und den dann mit Kohlensäure zu versetzen.“ Das Ergebnis ist der Sparkling Rocco, ein alkoholfreier Apfelsekt. Florian Lair kommt 2023 dazu, mit 19 Jahren. „Ich habe mein erstes Unternehmen gegründet, als ich 14 war.“ Er sagt das so, als wäre das normal. Die Entscheidung, bei Sparkling Rocco einzusteigen, fiel spontan. „Da will ich mit dabei sein.“ Der Onlinehandel war nicht geplant. Doch die Pandemie zwang zur Digitalisierung. Das Ergebnis? Überraschung. „Wir dachten nie im Leben, dass so viele Privatkonsumenten online unser Produkt kaufen würden.“
Wieder eine Lektion aus Südtirol: Manchmal führen ungeplante Wege zu den besten Zielen. Nicht ganz ungeplant ist hingegen unser letzter Stopp. Im Castel Hörtenberg in Bozen. Hier verbindet im Restaurant Le Segrete Küchenchef Armin Elezi traditionelle Fermentationstechniken mit moderner Kreativität. Ein Ort, wo nachhaltiger Genuss und handwerkliche Raffinesse aufeinandertreffen. Die Teller erzählen Geschichten. Von der engen Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten. Vom Streben nach minimalem Abfall. Der Blick schweift über die Lichter Bozens, die Menschen genießen den lauen Abend, sie lieben ihre Traditionen. Und morgen arbeiten sie wohl weiter an der Zukunft. An Ideen, die die Welt verändern können.
Und dann haben wir sie gefunden, die Antwort auf die Frage „Wer bist du, Südtirol?“. Ein Sehnsuchtsort. Aber nicht nur für Menschen, die Urlaub machen möchten (oder unbedingt dieses eine Bild von den Drei Zinnen auf Instagram uploaden wollen). Sondern auch für Menschen, die ihre Ideen wachsen lassen wollen. Die an morgen denken. Während sie gleichzeitig das Heute genießen. „Un altro caffè, per favore!“_
Redaktion
- Susanna Winkelhofer
Fotos
IDM Südtirol Alto Adige Luca Putzer, Ivo Corra’ fotografo, Valentin Pellio