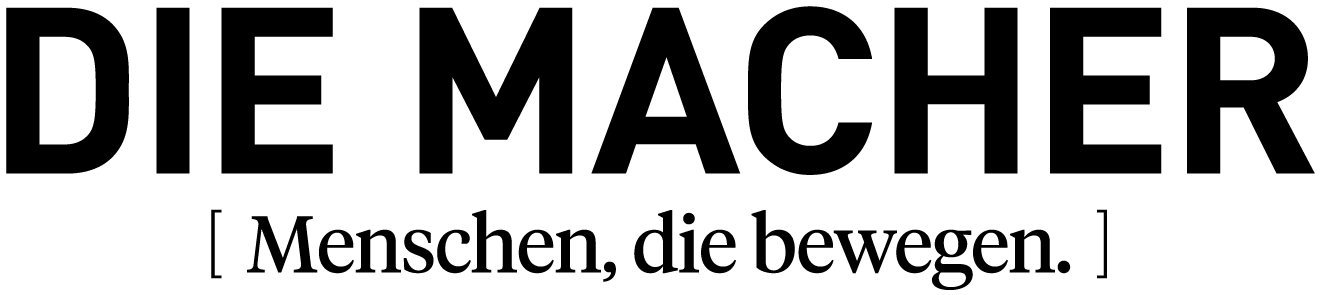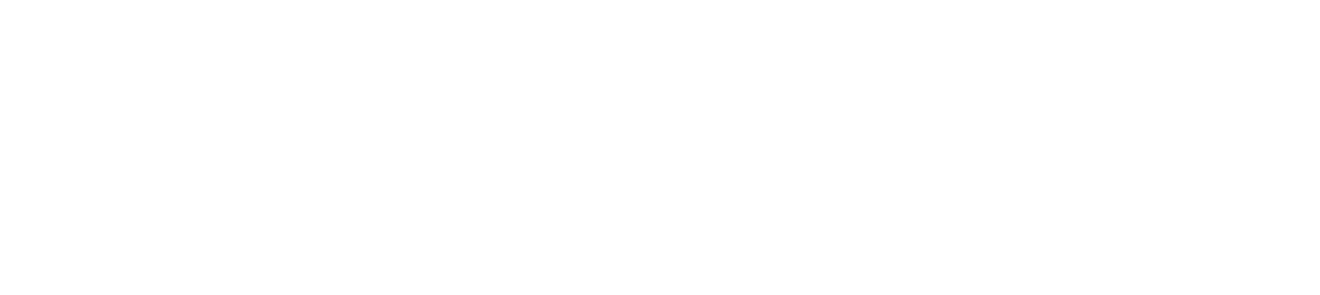Wenn Vereinbarkeit zur Kultur wird
Wie gelingt Vereinbarkeit von Familie und Beruf wirklich? Maria Gratzl gestaltet sie bei LIWEST aus der Praxis heraus – Elisabeth Wenzl begleitet sie auf struktureller Ebene bei Familie & Beruf Management GmbH. Beide zeigen: Ohne Haltung und Flexibilität geht es nicht.
Als Maria Gratzl sich vor einigen Jahren mit ihrem Lebenslauf bewarb, war sie nicht nur hochqualifiziert – sondern auch jung, Mutter und auf der Suche nach einer Teilzeitstelle. „Für die wirklich interessanten Jobs wollte niemand eine Teilzeitkraft“, erinnert sie sich. Ihr Wunsch: flexibel arbeiten und gleichzeitig wieder in eine anspruchsvolle Position einsteigen. Die Rückmeldungen? Vorsichtig ausgedrückt: zurückhaltend. „Da habe ich mir gedacht: Euch zeige ich’s – und wenn ich einmal die Chance bekomme, etwas zu verändern, dann werde ich das tun.“ Es ist dieser Satz, der bis heute wie ein roter Faden durch Gratzls Karriere führt – und inzwischen auch durch die Unternehmenskultur von LIWEST, wo sie heute den Bereich People & Culture leitet.
Drei Tage, die alles verändert haben
Denn der Wiedereinstieg gelang ihr schließlich bei LIWEST – mit drei Tagen pro Woche. „Ich hatte daheim ein Kind, das hat mich gefordert. Und ich hatte im Job die klare Haltung: Wenn ich da bin, bin ich da. Als Teilzeitkraft bist du gefühlt produktiver. Du hast keine Zeit, zu trödeln, und arbeitest fokussiert.“ Aus dem kleinen Einstieg ist mittlerweile ein professionelles HR-Team gewachsen – und eine moderne Arbeitgebermarke, an der Gratzl entscheidend mitgebaut hat.
Denn ihre eigene Geschichte prägt bis heute, wie sie ihre Rolle versteht. Vereinbarkeit ist für sie kein Schlagwort, sondern gelebte Realität: „Ich weiß, was es heißt, wenn das Kind krank ist. Oder wenn man als Mutter selbst krank ist. Ich weiß, wie wichtig Strukturen im Unternehmen sind – aber auch das Mindset bei Führungskräften.“
Ein Add-on, das eine familienfreundliche Arbeitskultur bringt: „Mitarbeitende, die eine Familie haben, sind oft sehr stabil. Die bauen ein Haus, bekommen Kinder – und orientieren sich nicht dauernd neu.“ Außerdem bringen sie aus ihrer privaten Verantwortung Kompetenzen mit, die auch im Job wirken: „Wer drei Kinder organisiert, kann auch eine Gruppe moderieren.“
„Ich will keine Aktionitis“
Bei LIWEST ist dieses Mindset inzwischen systematisiert: Das Unternehmen versteht sich als Caring Company, die Mitarbeitende durch ihre individuellen Lebensphasen begleitet. Statt starrer Konzepte geht es darum, flexibel zu reagieren: Shared Leadership, Desk-Sharing, Homeoffice, Elternrückkehrmodelle ohne Positionsverlust – all das ist heute gelebte Praxis. „Ich will keine Aktionitis, sondern Gleichbehandlung, die immer da ist“, sagt Gratzl. Das bedeutet auch: Diversität, die nicht nur aus Checklisten besteht. „Mir ist egal, ob jemand 50 oder 70 ist, welches Religionsbekenntnis oder welches Geschlecht eine Person hat – wenn sie gut ist, wenn sie passt, dann nehmen wir die Person.“ Und das funktioniert. Besonders stolz ist sie darauf, dass es LIWEST gelungen ist, als technologiegetriebenes Unternehmen einen Frauenanteil von rund 30 Prozent in Führungspositionen zu erreichen – inklusive weiblicher IT-Teamleiterinnen.
Damit Vereinbarkeit nicht an internen Hürden scheitert, braucht es mehr als flexible Modelle – es braucht ein Kulturverständnis, das auf Vertrauen basiert. „In unserem Führungsleitbild stehen Vertrauen und Respekt im Zentrum. Ohne diese Werte geht eine flexible Arbeitskultur nicht.“ Und dass es diese nicht nur heute, sondern auch in Zukunft unbedingt brauche, ist für Gratzl keine Frage. „Die Arbeitswelt wird sich ändern müssen – der Pool an Arbeitnehmenden wird immer kleiner, und wir brauchen jede Arbeitskraft.“
Impulse aus der Koordination
Auch Elisabeth Wenzl, Geschäftsführerin der staatlichen und gemeinnützigen Familie & Beruf Management GmbH, unterstreicht die Bedeutung eines kulturellen Wandels. Dieser brauche sowohl Commitment der Unternehmensführung als auch der Mitarbeitenden.
Genauso wie Gratzl sieht auch Wenzl das Thema nur dann als effektiv, wenn es in der Unternehmenskultur verankert ist. „Eine familienfreundliche Kultur bringt gewisse Benefits mit sich, damit Vereinbarkeit gelingen kann. Bei reinen Benefits, die aber nicht von der Unternehmenskultur getragen werden, bleiben viele Synergien zu wenig genutzt“, sagt sie. Familienfreundlichkeit müsse als Ganzes gedacht werden, nicht als punktuelles Extra.
Struktur schafft Wirkung
Dass es „die eine“ Lösung nicht gäbe, ist sich Wenzl sicher. Die Maßnahmen für Familienfreundlichkeit seien je nach Unternehmen individuell und passgenau zu gestalten. Als nationale Koordinierungsstelle für Vereinbarkeit unterstützt Wenzls Organisation das Engagement der Unternehmen und macht dieses auch sichtbar durch das staatliche Gütesiegel „audit berufundfamilie“. Damit wird Familienfreundlichkeit im Unternehmen strukturiert erfasst und weiterentwickelt. „Es entstehen klare Ziele, Verantwortlichkeiten und ein Bild, wie Familienfreundlichkeit im Unternehmen Schritt für Schritt gelingen kann“, erklärt Wenzl.
Vereinbarkeit ist kein Generationenprojekt, sondern ein Thema für alle – das bestätigen die beiden Perspektiven von Maria Gratzl und Elisabeth Wenzl. Was sie auch zeigen: Der Trend der Individualisierung ist gekommen, um zu bleiben. Auch am Arbeitsplatz. Und wie Wenzl es formuliert: „Wie wir in fünf oder zehn Jahren arbeiten, ist nicht klar. Das Bedürfnis, Familie und berufliche Tätigkeit gut leben zu können, hat aber wohl sicher Bestand.“_
Redaktion
- Zofia Wegrzecka
Fotos
Dang Tran,
Harald Schlossko