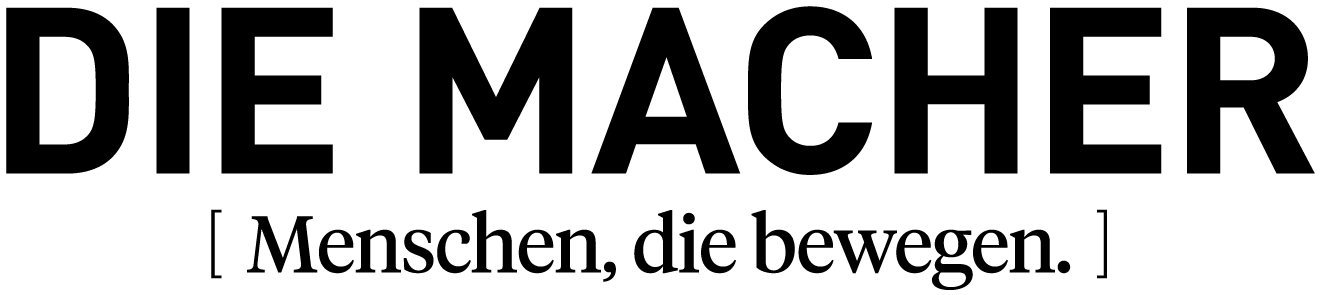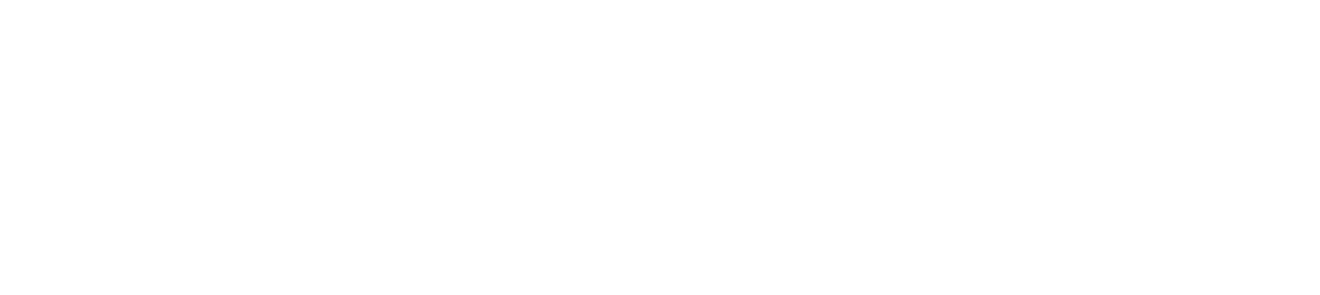Bleib neugierig. Mach Pausen. Vergiss Micromanagement.
Christina Wilfinger war immer schon neugierig. Sie liebt Musik. Und Technik. Und Wirtschaft. Und das alles verbindet sie. Aus der Musik hat sie viele Analogien für ihre Führungsaufgaben mitgenommen. So viel vorweg: „Du musst den Takt angeben, genau zuhören und Gestaltungsspielraum geben. Das macht für mich Führung aus.“ Heute führt die ehemalige Microsoft- und SAP-Geschäftsführerin als Aufsichtsrätin, Investorin und Beraterin durch eine Zeit des radikalen Wandels. Ihre Botschaft an Führungskräfte: Mut zur Veränderung ist nicht optional – er ist überlebensnotwendig.
Das Du-Wort kommt Christina Wilfinger so selbstverständlich über die Lippen wie der Kaffee auf den Tisch. Sie war viel im internationalen Raum unterwegs, im Englischen stellt sich die Frage nach dem Du nicht, und das findet sie gut. Überhaupt braucht sie keine Floskeln, um Respekt zu erfahren. Den erfährt sie sowieso. Selbstbewusst war die gebürtige Steirerin, die heute in Wien lebt, verheiratet ist und eine sechsjährige Tochter hat, nämlich immer schon – wenn auch nicht immer mit dieser Gelassenheit wie heute, erklärt sie.
Wir treffen Christina im Private Members Club AM HOF 8 in der Wiener Innenstadt. Hier ist sie Clubmitglied, meist nutzt sie einmal die Woche die Räumlichkeiten für Geschäftsessen, Businesstermine, Ideenschmieden auf der Dachterrasse. Sie investiert in Startups, berät Konzerne und sitzt in Aufsichtsräten – immer auf der Suche nach dem nächsten Moment, in dem alles möglich wird. Ein eigenes Büro, mal abgesehen vom Homeoffice, brauche sie nicht mehr. In ihren Aufsichtsratsfunktionen sei sie ohnehin bei den Unternehmen vor Ort. Was sie aber immer noch gerne braucht, sind ihre Highheels. Die trägt sie so mühelos den ganzen Tag wie andere Turnschuhe, nur natürlich mit mehr Haltung.
Die Pause gibt den Ton an
Als Wirtschaftsingenieurin mit Fokus auf Informatik versteht sie die Technik. Als Musikerin versteht sie die Menschen. Die Kombination macht Christina zu einer seltenen Spezies in der Führungsetage. Und dort sei es keineswegs immer perfekt, sollte es auch gar nicht sein (aber dazu später). Damit man hier diese nahezu perfekten Momente im Einklang – wie bei einem Konzert – erleben könne, „braucht es ein Zusammenspiel von ganz vielen besonderen Faktoren: die richtigen Personen, die richtigen Instrumente, die richtige Situation, die richtige Stimmung – also das richtige geopolitisch-wirtschaftliche Umfeld“. Und: Pausen! „Das Wichtigste in der Musik sind die Pausen.“ Die Stille zwischen zwei Takten. Der Moment, in dem hundert Musizierende gleichzeitig den Atem anhalten. Ohne sie wäre die Musik nur Lärm. Die Pause gibt der nächsten Note ihren Sinn, ihre Kraft, ihre Schönheit. Sie schafft Raum für das Unausgesprochene. Dass es auch in der Wirtschaft genau diese Pausen brauche, war ihr nicht von Anfang an bewusst. „Das musste ich erst lernen: sich auch mal bewusst zurücknehmen, reflektieren, nicht zu schnell mit den Ideen rausschießen. Das ist ein Lernprozess.“
Lernprozesse würden für Führungskräfte ohnehin dazugehören. Gerade jetzt, in diesem stetigen Wandel, bräuchten sie vor allem eine ganz wesentliche Eigenschaft: „Dieses Annehmen, dass die Unsicherheit nicht mehr weggehen wird. Das waren wir in den letzten 60, 70 Jahren in der Businesswelt nicht gewohnt – so viel Unsicherheit, so viele unterschiedliche makroökonomische Faktoren und geopolitische Einflüsse …“ Vor zehn Jahren hätte niemand für möglich gehalten, dass wir über tatsächlichen Krieg vor der Haustür diskutieren. „Das sind Faktoren, mit denen wir in den klassischen Managementlehren nicht groß geworden sind.“ Diese Unsicherheitsfaktoren zu akzeptieren, aber trotzdem den Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen – das sei die große Kunst. „Und nicht abzuwarten, noch mal zu überprüfen. Verantwortung übernehmen heißt Entscheidungen treffen. Mutig entscheiden.“ Gerade im DACH-Raum nehme sie wahr, dass man oft sehr zögerlich mit mutigen Entscheidungen sei.
Christina Wilfingers To-dos. Für Führungskräfte.
#HEUTE
„Direktes Feedback geben; das persönliche Gespräch suchen; Innovationswillen nicht nur sehen, sondern auch honorieren.“
#MORGEN
„Eine Nacht darüber schlafen. Am nächsten Tag schaut die Welt meistens ein bisschen anders aus. Ein paar Stunden Schlaf haben selten geschadet.“
#ÜBERMORGEN
„Den Generationenmix fördern: bewusst verschiedene Altersgruppen und Erfahrungslevel in Teams kombinieren, um diese gegenseitige Befruchtung zusammenzubringen.“
Die Kunst des Scheiterns
Und ja, manche dieser Entscheidungen könnten auch Fehler sein. „Fehlerkultur ist mal schnell in eine hübsche Strategiepowerpoint gepackt – sie wirklich zu leben, ist noch einmal eine ganz andere Challenge.“ Sie kennt das Problem aus eigener Erfahrung. Als junge Führungskraft grätschte sie dazwischen, wenn Mitarbeitende Fehler machen wollten. „Das ist klassisches Micromanagement.“ Das Ergebnis sei verheerend für alle Beteiligten: „Am Ende des Tages haben beide Seiten nichts davon. Die Person hat den Fehler vermieden und konnte daraus nicht lernen. Und du als Führungskraft hast genau diesen Fehler begangen, den du nicht begehen solltest.“ Christina vergleicht es mit der Kindererziehung, mit „diesen Wattebäuschchen, nur damit nichts passiert“. Aber echtes Lernen entstehe nur durch eigene Erfahrung – auch durch Scheitern. „Das ist ein gesellschaftliches Phänomen, das es immer wieder aufzubrechen gilt.“
Zurück im Orchestergraben würde das bedeuten: „Führung ist Komposition, nicht Kontrolle.“ Und für Führungskräfte, die neu in ein Unternehmen geholt werden, hat sie noch einen Tipp aus der Musik: „Jedes Orchester hat seine eigene Klangfarbe. Wenn man als Dirigent neu dazukommt, geht es zunächst darum, gut zuzuhören, diese Nuancen zuzulassen, aber dann auch neue Impulse zu geben, neue Akzente zu setzen.“
Die 80-20-Regel
Man muss sich oft mit 80 Prozent zufrieden geben und 20 Prozent Improvisation zulassen.“ Christina sagt das, als würde sie ein Naturgesetz erklären. Als Wirtschaftsingenieurin hat sie gelernt, dass es für alles eine Lösung gibt. Als Führungskraft hat sie gelernt, dass 80 Prozent Lösung oft mehr wert sind als 100 Prozent Warten. „Alles perfekt zu schaffen, ist nicht realistisch.“ Die 20 Prozent Improvisation sind kein Eingeständnis von Schwäche. Sie sind der Spielraum für das Unerwartete. Für die Momente, in denen Pläne zu Durchbrüchen werden.
„Wer, wenn nicht wir!“ Das war ihr Lieblingssatz als Geschäftsführerin, wenn das Team vor scheinbar unlösbaren Aufgaben stand. Der Moment, in dem aus Zweifeln Gewissheit wird. Kein Motivationsgeschrei, sondern nüchterne Bestandsaufnahme: Die Kompetenzen sind da, die Erfahrung, die Ressourcen. Es war ihre Art, dem Team die Stärke zurückzugeben, ohne die Probleme kleinzureden: „Das wird jetzt nicht lustig, und das wird nicht einfach, aber wir nennen das Kind beim Namen. Und dann lösen wir das gemeinsam.“
Dazu brauche es Gespür, Intuition und Kreativität. Genau jene Bereiche, in denen Menschen in Zeiten der Digitalisierung noch unersetzbar seien. „Mit den heutigen technologischen Möglichkeiten und Werkzeugen hat dieses Menschsein eine noch größere Bedeutung bekommen.“ Führungskräfte als Menschen, nicht als Manager also: „Man muss die Ängste der Leute ernst nehmen, sie bewusst mitnehmen, bis zu einem gewissen Grad Transparenz geben und ehrlich sein. Klare Ansagen machen und die Richtung vorgeben. Und nicht diese Unsicherheit ausstrahlen.“ Das sei natürlich ein Spagat, den man tagtäglich auszubalancieren habe. Eines ihrer größten Learnings: „Wenn du willst, dass sich deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie erwachsene Menschen verhalten, dass sie aktiv sind, sich etwas trauen, mitdenken –
dann musst du sie auch so behandeln.“
Innovation – aber wie?
Dann kann sie möglich werden: Innovation. „Innovation braucht ein System, nicht nur gute Absichten. You get what you measure“, sagt Christina mit der Präzision einer Frau, die schon viele gescheiterte Innovationsprojekte gesehen hat. „Du musst Innovation und Mut positiv belohnen, in irgendeiner Form auch spürbar, messbar machen.“ Es reiche nicht, Innovation auf die Website zu schreiben und in Präsentationen zu beschwören, „sondern man muss sie auch wirklich in ein Performance-Management-System umsetzen“. Sie plädiert für konkrete Incentivemodelle, für Bonussysteme, die Risikobereitschaft honorieren statt bestrafen. Innovation müsse kommuniziert werden, bevor sie im Tagesgeschäft untergeht. Ihre Erkenntnis: Gute Innovationsprojekte scheitern oft nicht an der Idee, sondern daran, dass niemand davon erfährt.
Christina steht auf. Ihre Highheels fest am Boden. Bereit, den nächsten Schritt in die Zukunft zu machen. Was sie antreibt? Grundneugierde. „Und dass ich von repetitiven Themen sehr schnell gelangweilt bin.“ Wenn etwas läuft, wenn etwas gut funktioniert, brauche es sie nicht mehr. Technologisch sei es gerade so spannend wie nie zuvor. „Es ist einfach irre, wo wir uns hinentwickeln. Das mitzubegleiten und gestalten zu dürfen, ist sehr spannend.“ Es gebe unglaublich viel zu tun, unglaublich viele Chancen. Europa müsse aufhören, zu jammern, und anfangen, zu gestalten. Die Werkzeuge seien da, die Talente auch. Was fehle, sei der Mut. „Nicht schlechtreden, sondern die Möglichkeiten in den Vordergrund stellen.“ Es ist ein Appell, der über Unternehmensführung hinausgeht. Ein Appell an eine ganze Gesellschaft._
KLAR.TEXT
Welche Frage sollten Mitarbeitende öfter stellen?
Christina Wilfinger: Wie und warum?
Was ist die meistunterschätzte Führungsqualität?
Christina Wilfinger: Zuhören.
Welche Führungsgewohnheit sollte dringend abgeschafft werden?
Christina Wilfinger: Micromanagement.
Was ist die derzeit größte Bremse für Innovation in Europa?
Christina Wilfinger: Die Zögerlichkeit. Wir evaluieren erst den gesamten Risikokatalog, bevor wir etwas probieren.
Redaktion
- Susanna Winkelhofer
Fotos
Antje Wolm