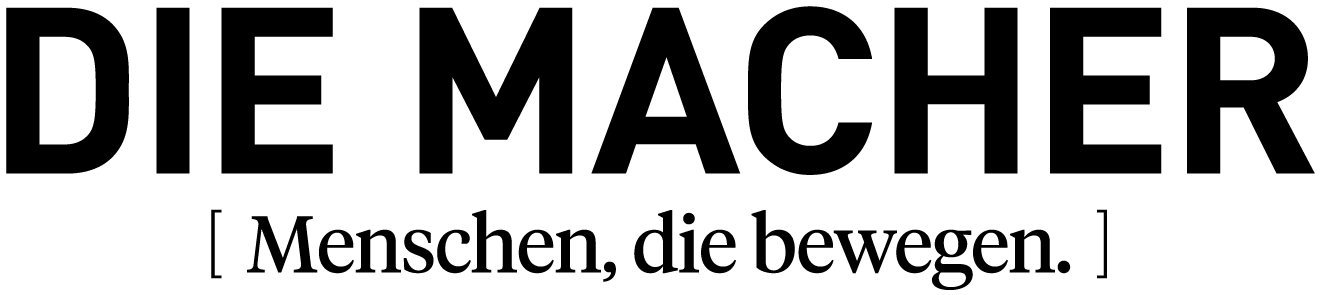Der Blick auf die andere Seite
Geht man zum Arzt, kümmert man sich wenig darum, wie es dem Arzt geht. Die Stationspflegerin, die einem das Blut abnimmt, fragt man selten nach ihren Sorgen. Dabei sind es genau diese Menschen – der Pfleger, die Ärztin, der Therapeut, die Sozialberaterin –, die unsere Gesellschaft tragen. Wahre Alltagsheldinnen und -helden, die im Helfen ihren Traumjob gefunden haben. Und dafür sind wir ihnen dankbar. Sehr sogar. Heute wollen wir mal auf die andere Seite blicken – und die Frage zurückstellen: Wie fühlst du dich? Was beschäftigt dich? Was treibt dich an?
30 Stunden in der Woche arbeitet Barbara Steinböck als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin im Klinikum Wels-Grieskirchen. Als Mama zweier Kinder ist es ihr wichtig, genug Zeit für ihre Familie zu haben. Ein Wunsch, bei dem ihr (sowie auch ihren Kollegen) ihr Arbeitgeber gerne entgegenkommt – in Form individueller Lösungen. Denn flexible Arbeitszeitmodelle werden immer beliebter. In Barbaras Fall bedeutet das: freie Nachmittage unter der Woche, dafür ab und zu Wochenenddienste oder Nachtschichten. Für die 42-Jährige ist das ein ideales Konzept. „Meine Bedürfnisse werden bei der Diensteinteilung berücksichtigt, es wird respektiert, dass man auch ein Privatleben hat.“
Die Sache mit der Resilienz
Wie jeder Job bergen auch Berufe im Gesundheitswesen ihre Schattenseiten. Stress, körperliche und psychische Belastung sowie lange Schichten gehören zum Arbeitsalltag. Was dabei relevant ist: Resilienz. Kein Modewort, sondern eine essenzielle Eigenschaft für die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens und vor allem für die Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Gute Unternehmen erkennen die Notwendigkeit, ihr Team zu stärken. Das Klinikum Wels-Grieskirchen ist ein Paradebeispiel – nicht nur in puncto Widerstandsfähigkeit, auch in anderen Handlungsfeldern, die die Zufriedenheit am Arbeitsplatz stärken. In Kursen zur Resilienzförderung lernen die Mitarbeitenden den Umgang mit Stress und schwierigen Gefühlen im Beruf und im Alltag.
Das „Danke“ als Treibstoff
Auch die selbstständige Altenpflegerin Any Godja ist mit ihrem Job sehr glücklich. Sie hält den Pflegeberuf für einen sehr wertschätzenden Beruf. Das „Danke“ von dementen Pflegeheimbewohnern sei eine Sache, die sie für keinen anderen Job, egal wie gut bezahlt, hergeben würde. Für Any ist es ein Herzensprojekt, das Image der Pflege zu verbessern. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Mark Jonas Fedl, einem Pflegeassistenten, führt sie den erfolgreichen Podcast „Kathetertalk“. Wöchentlich räumen die beiden mit Pflegeklischees auf, teilen humorvolle Anekdoten aus ihrem Arbeitsalltag und haben vor allem ein Ziel: das Bild, das gerade junge Menschen von der Pflege haben, zu ändern.
Auch für Mark ist das Schönste an seinem Beruf die Dankbarkeit seiner Patienten. Es sind die kleinen Momente. Zum Beispiel, wenn er die Haare einer Patientin kämmt und ihr glückliches Gesicht sieht – ein unbeschreibliches Gefühl. „Das ist so viel mehr wert als irgendein Lob von einer Chefin oder eines Kollegen. Mir persönlich gibt das einfach am allermeisten.“ Und wie sieht es mit der Sache aus, „über die man in Österreich nicht spricht“, dem Gehalt? Mark kann sich nicht beschweren. „Dafür, dass ich eine einjährige Ausbildung habe, ist mein Verdienst mit dem Stundenumfang definitiv gerechtfertigt.“ Die besten Botschafter für den Pflegeberuf sind nun mal die Pflegekräfte selbst. Das erkennt auch der oberösterreichische Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer: „Wenn man mit Mitarbeitenden spricht, sind die erfüllt und gehen jeden Tag gerne in die Arbeit. Ja, es gibt Regentage, aber es gibt auch Sonnentage und du machst etwas Sinnstiftendes.“
Abwechslung gesucht? Gefunden!
Aufstiegschancen? Die gibt es in der Pflege nicht. Zumindest, wenn man den Klischees glaubt. Die Realität sei anders. Eine Vielfalt an Einsatzbereichen und Möglichkeiten wird im Sozialbereich geboten – der Aufstieg von der Hilfskraft zur Stationsleitung, verschiedene Arbeitsfelder vom Akutbereich im Krankenhaus bis zur Behindertenpflege. „Das ist eine megagroße Branche und eine Tätigkeit, bei der dir dein ganzes Leben lang nicht fad wird. Und dann kannst du nebenher auch noch Podcasts aufzeichnen“, meint Any augenzwinkernd. Vor allem für die Gen Z, die sich nach Vielseitigkeit und Sinnstiftung sehnt, sei die Pflege aus diesem Grund ein passender Beruf.
Menschliche Stützräder
Ein anderer Beruf aus der vielfältigen Palette des Sozialbereiches ist die Lebens- und Sozialberatung. Attraktiv für jene, die abseits des medizinischen Metiers mit Menschen arbeiten möchten. Was es damit auf sich hat? Das beantworten die beiden Vorstandsmitglieder des „Österreichischen Verbands der Lebens- & SozialberaterInnen“: Andrea Einzinger und Stephanie Niederhuber. „Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe“, erklärt Stephanie. Das könne man sich ein bisschen so vorstellen, wie wenn man einem Kind das Fahrradfahren beibringen würde. Da begleitet man das Kind auch eine Weile und hilft ihm erst mal, das Gleichgewicht zu halten, sich in die neue Situation einzufühlen und die Angst zu minimieren. Lässt man das Rad zu früh los, stürzt das Kind. So muss auch mit Menschen in einer akuten Krisensituation umgegangen werden. Sei es eine abrupte Lebensänderung oder Unzufriedenheit mit der aktuellen Lebenssituation. „Meistens ist es so, dass man die Menschen stabilisieren muss, damit sie erst mal wieder atmen können“, erklärt Andrea den Prozess. „Oftmals sehen wir zwar schon Wege, für die die Klienten aber noch nicht bereit sind.“ Durch eine nondirektive Weise der Beratung werden diese selber zu Schritten geführt, die für sie umsetzbar sind.
Geduld ist in diesem Job angesagt. Manchmal vergehen Jahre, bis Klienten bereit sind, bestimmte Veränderungen zu wagen oder Denkmuster aufzulösen, die für Beraterinnen bereits früh sichtbar waren. Der ganze Prozess und die Beziehung seien sehr bereichernd. „Ich bin nicht nur hilfreich für meine Klienten und Klientinnen, ich lerne auch immer von ihnen. Es ist ein Geben und Nehmen“, betont Stephanie.
Keine Einzelkämpfer
Auf die LSB-Ausbildung folgt eine Menge an Praktikumsstunden sowie Einzel- und Gruppensupervisionen. Da die Lebens- und Sozialberatung ein gewerblicher Beruf ist, kann es vorkommen, dass man sich „allein auf weiter Flur“ fühlt. „Im Verband ist man nicht alleine. Wir bieten Möglichkeiten zur Vernetzung, man kann unser Wissen anzapfen und wir stellen Werbematerial zur Verfügung“, erklärt Stephanie. Vor allem steht man nicht als Einzelkämpferin da, sondern kann den Verband als Rückhalt nutzen, zum Beispiel in Gesprächen mit Institutionen. Zudem will der Verband psychosoziale Beratung in der Gesellschaft verankern, enttabuisieren und als Sprachrohr dienen. Ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit ist das Mitwirken bei der Firmenchallenge 2023. „Tägliche fünfzehnminütige Sessions, sogenannte ‚mental breaks‘, wurden von LSBlern geleitet, und eine Woche lang haben wir täglich Workshops angeboten“, erklärt Andrea die Kooperation mit der Wirtschaftskammer Wien. Durch diverse Projekte und Initiativen wurde der Beruf bereits sichtbarer gemacht. Und die Reise geht weiter.
Irmtraud Ehrenmüller
5 Fragen an Irmtraud Ehrenmüller
Irmtraud Ehrenmüller ist FH-Professorin für Organisation und Prozessmanagement an der FH OÖ. Sie forscht auf dem Gebiet der Robotik in der Pflege, ein Thema, zu dem wir ihr fünf Fragen gestellt haben:
Frau Ehrenmüller, welche Faktoren sind ausschlaggebend für die Überlastung von Pflegepersonal?
Irmtraud Ehrenmüller: Es sind nicht die Aufgaben an sich, sondern die Seiteneffekte des Personalmangels, die belastend sind. Pflegekräfte stehen unter immensem mentalen Stress, da sie unter ständigem zeitlichen Druck fehlerfrei arbeiten müssen. Diese Belastung hindert sie daran, am Ende der Schicht in Ruhe heimzugehen und zu regenerieren.
Sie arbeiten an digitalen Wegen, um Pflegepersonal zu entlasten. Wie sehen solche Lösungen aus?
Irmtraud Ehrenmüller: Für uns ist essenziell, dass die Technologie sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der Pflege orientieren muss. Sie soll Pflegende in ihrer Tätigkeit am Menschen unterstützen, anstatt sie noch mehr zu belasten, wie es bei technologieorientierten Lösungen oftmals der Fall ist.
Können wir uns in Zukunft auf humanoide Roboter gefasst machen, die durch das Krankenhaus wuseln?
Irmtraud Ehrenmüller: Das ist mehr Spielrobotik. Lieb, aber nicht nützlich. Vielmehr geht es um Entwicklungen, die etwa Transportdienste unterstützen, oder beispielsweise Datenbrillen, die bei der Pflegedokumentation helfen. Was heute auch schon Standard ist, sei das technologiegestützte Verblistern von Medikamenten, die auf Patienten abgestimmt, abgezählt, verpackt und geliefert werden – alles automatisiert.
Bedeutet Robotik im Pflegebereich neue Anforderungen an den Pflegeberuf?
Irmtraud Ehrenmüller: Durchaus. Es wird eine gewisse digitale Kompetenz brauchen. Wir gehen davon aus, dass dies den Pflegeberuf für junge Leute sehr viel attraktiver macht. Das heißt aber nicht, dass etablierte Pflegekräfte damit aus dem Markt geworfen werden. Neue Entwicklungen müssen intuitiv bedienbar sein und ein Pflegeberuf soll keine Informatikkenntnisse erfordern.
Beamen wir uns mal in die Zukunft. Wie wird
ein Krankenhaus in 50 Jahren aussehen?
Irmtraud Ehrenmüller: Also jedenfalls ganz anders als heute. Wahrscheinlich wird sehr viel technologieunterstützt passieren – im häuslichen Umfeld, durch Distance-Medicine. Also es wäre gar nicht mal so, dass der Patient ins Krankenhaus geht, sondern dass das Krankenhaus zum Patienten kommt. Und es wird sehr viel Big-Data-gestützt mit Automatisation oder Robotik gemacht werden._
Redaktion
- Susanna Winkelhofer, Zofia Wegrzecka
Fotos
Land OÖ, Nik Fleischmann,
MMH, privat,
B-Plank imBilde.at